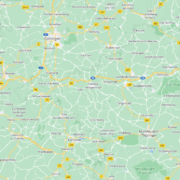Der mehrfache Stuntriding Weltmeister Christian „Pfiff“ Pfeiffer ist tot. Ein persönlicher Nachruf.
In den Neunzigern sah ich beim „Tag der offenen Tür“ des TÜV Göttingen einen hageren jungen Kerl, der mit seiner Trialmaschine irrwitzige Stunts vorführte. Das Publikum feierte ihn frenetisch und nahezu jeder Biker, der ihn sah, fragte sich, wie das wohl gehen mochte, was der Kerl mit dem Motorrad anstellte. Doch es war damals nur ein Witz gegen das, was Chris später tat. 2003 war ich Redakteur bei MOTORRAD und Chris, den die ganze Welt nur Pfiff nannte, bewegte für eine Story drei Bikes auf einem Flugfeld – wieder mal am Rande der physikalischen Grenzen. Pfiff war nahbar, warmherzig, höflich, hilfsbereit und offen. Wir verstanden uns auf Anhieb. Und so saß ich einige Wochen später bei ihm daheim, um ein Porträt zu schreiben. Er, der Superstar der Enduroszene, der bis zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Mal das Erzberg-Rodeo gewonnen hatte und die Menschen rund um den Globus mit seinen Stunt-Shows zum Stauen brachte, nahm mich mit in seine private Welt. Spielte mir die Musik vor, die er gern hörte, teilte das Essen, das er liebte, integrierte mich in seine kleine Familie und sprach offen über eine sehr schwierige Zeit, die er überstanden hatte. 1999 war sein bis dato schwärzestes Jahr. Drei Unfälle, sechs OPs, eine Hiobsbotschaft: Der letzte Sturz – gebrochenes Jochbein, Handgelenk, Kniescheibe, teils zersplittert – bedeute das Karriereaus für den Sunnyboy, erklärten ihm die Ärzte. Weiterhin Sport zu treiben sei unmöglich. Chris sagte damals: „Also bin ich von Arzt zu Arzt gerannt, bis ich einen fand, der mir Hoffnung gab.“ Hoffnung! Fragt man Wikipedia, erhält man folgende Definition: Hoffnung ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht.
Chris fand diesen einen Arzt, der ihm, den vermeintlichen Krüppel, Hoffnung gab. Und Pfiff kehrte wieder zurück ins Leben. Ein Jahr nach dem fatalen Sturz lehrte er seinem Schicksal, dass man alles erreichen kann, wenn man nur an sich glaubt und gewann das Erzbergrodeo erneut. Pfiff deklassierte die weltbesten Endurofahrer wenige Monate nach der Diagnose, für immer ein Krüppel zu sein. Und er wiederholte diesen Erfolg 2004. Überhaupt, seine Erfolge! Viermaliger Europäischer Stunt-Riding-Meister, viermaliger Stunt-Weltmeister. Unzählige gewonnene Rennen. Kaum zählbare Pokale. Er setzte neue Maßstäbe, wenn es darum ging, die Physik zu überlisten, war überaus kreativ, wenn es darum ging, neue Tricks zu finden und eroberte die Herzen seiner Fans rund um den Globus. Weil er nahbar war. Ohne Allüren. Ein Star zu anfassen. Ein Mann, der so weit oben zu stehen schien. Und dennoch seine Hand stets zu allen ausstreckte. Ich muss die Tränen niederringen, während mir all die Begegnungen mit ihm wieder präsent werden. 2011 trafen wir uns im Rahmen des 24-Stunden-Rennens am Nürburgring. Ich rief ihn an, sagte, dass alle aus der crazy Autotruppe, mit der ich am Streckenrand campte, ein Autogramm von ihm wollten. Und Pfiff kam vorbei. Presste diese Auszeit in seinen übervollen Terminkalender und machte es möglich. Überhaupt! Sein Terminkalender. Der Red Bull Markenbotschafter und Extrem-Sportler zeigte seine Shows in 94 Ländern der Erde auf allen Kontinenten. 90 Auftritte pro Jahr. Keine Seltenheit. Fünf Motorräder, die gleichzeitig auf dem Weg zu irgendeinem Event in der Welt waren und koordiniert werden mussten. Keine Hürde war ihm zu hoch, kein Weg zu weit, nichts schien für ihn unmöglich. Pfiff war der Rockstar unter den Stunt-Ridern, obwohl er das Wort Stunt bis zum Schluss nicht mochte. „Ich nenne mich lieber Akrobat“, hat er immer wieder gesagt. Und sich selbst dabei nicht so wichtig genommen, wie er eigentlich war.
2015 hängte er den Stunt-Helm an den Nagel. Das Leben auf der Überholspur erzwang einen Zwischenstopp. Pfiff war ausgebrannt. Konnte nicht mehr. Und suchte Hoffnung. Er, der Familienmensch, mit Ehefrau und drei Kindern, hatte zum ersten Mal richtig viel Zeit für seine Lieben. Und sein Leben. Vielleicht war es diese Zeit, die ihm auf ein Mal ein Bein stellte. Vielleicht hatte er mit all seinen Erfolgen, seinen Terminen und Reisen die Dämonen der Depression bis dato verdrängen können. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren sie plötzlich da und bedrängten ihn. Einen Mann, der sich die Hoffnung einst so tapfer zurückerobert hatte. Aber was tut so ein Mann, der alle nur denkbaren Erfolge erlebt, drei Kinder gezeugt, ein Haus gebaut hat und glücklich verheiratet war, wenn sich vor ihm das ruhige Meer statt wilde Berge ausbreiten?
Er kauft sich ein Boot. Pfiff war es – so präsentierte er sich auf den Social-Media-Kanälen bis zum Schluss – nie langweilig. Wir sahen ihn bei Instragram und Facebook, wie er mit seinen Kindern abenteuerte, wie er sich mit Elektrobikes ein Business aufbauen wollte, wie er verrückte Stunts mit seiner Honda Monkey machte. Wir sahen einen glücklichen Allgäuer im besten Alter, der beneidenswert war, weil er alles im Leben erreicht hatte. Was wir nicht sahen, war das große Zweifeln in ihm. Pfiff nahm nur noch wenige Jobs an. Und wenn er mit einer heiß gemachten Harley Sprintrennen gewann, oder sie im Anschluss in waghalsigen Drifts über die Strecke lies, staunten die Menschen wie eh und je. In den Pausen zwischen seinen Auftritten erlebte man Chris oft grübelnd, in sich gekehrt, zweifelnd. Ich hätte ihm gewünscht, dass er auch an diesem Punkt so lange einen Arzt gesucht hätte, bis er einen findet, der ihm die Hoffnung zurückgibt. Das ist nicht passiert. Manche behaupten, dass gleißendes Licht auch immer lange Schatten wirft. Es stimmt. Chris entschied sich am 12. März im Alter von 51 für den Freitod auf seinem Trainingsgelände. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie. Die Welt hat nicht nur einen der weltbesten Akrobaten verloren. Sondern einen Leuchtturm in tiefster Nacht. Mach’s gut, mein Freund. Danke, dass du da warst.